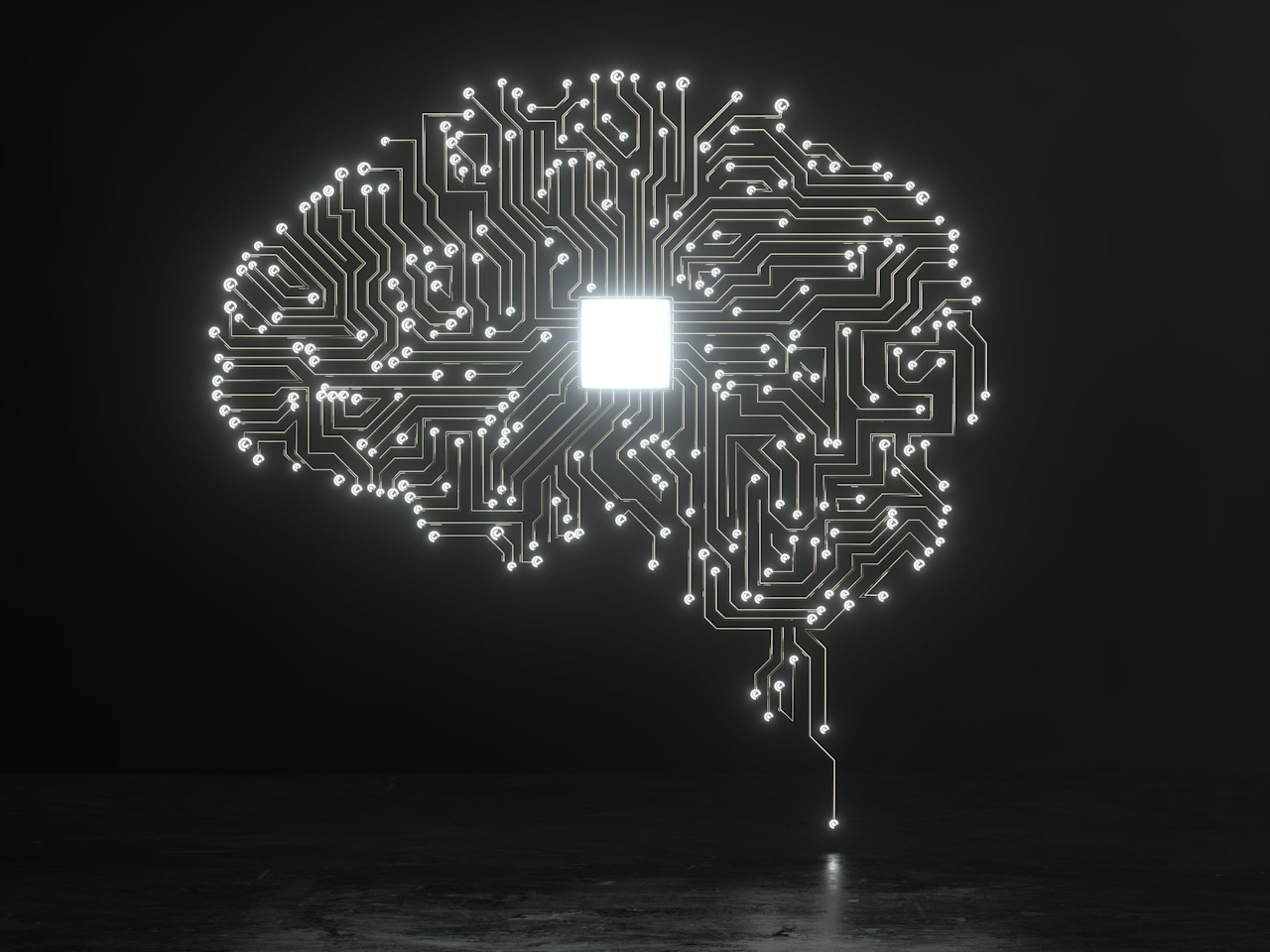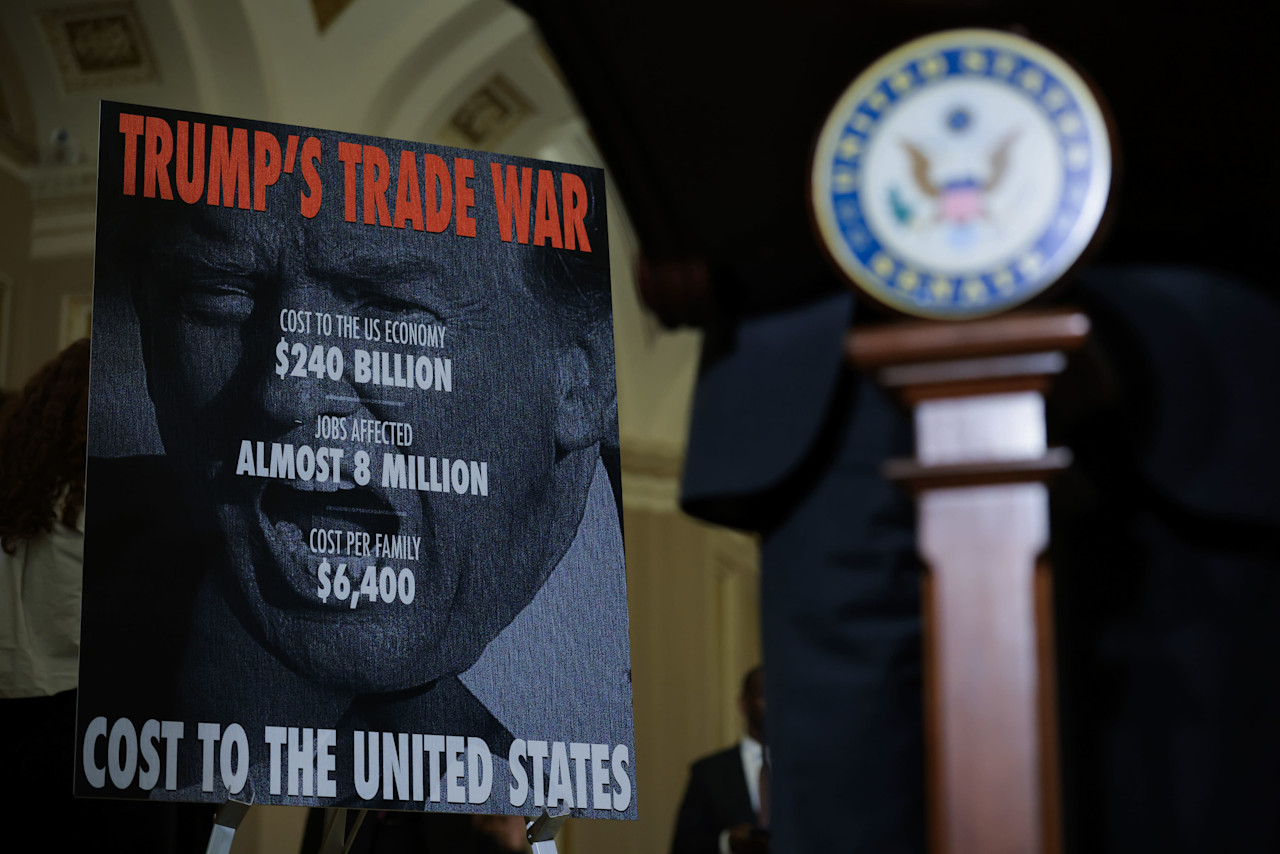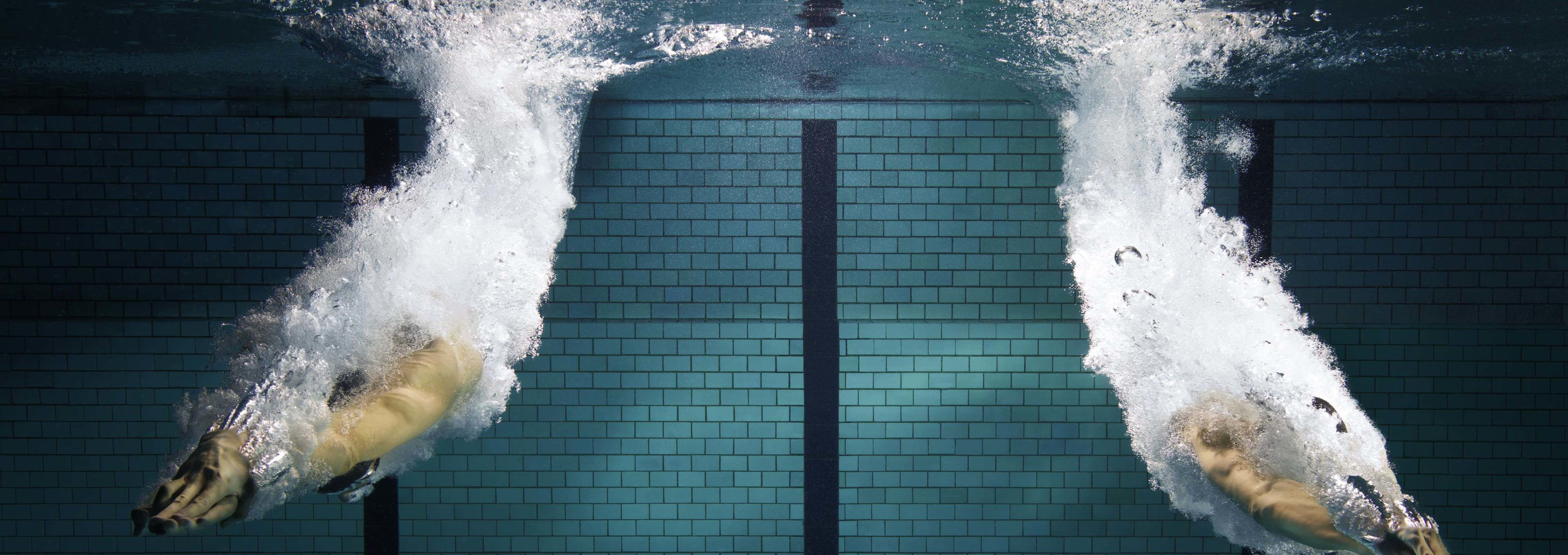

Indices Insights: Im Wettbewerb um Rendite machen Faktorprämien häufig das Rennen
Forschungen zeigen, dass einige Aktienmarktsegmente, beispielsweise unterbewertete oder hochwertige Unternehmen, stetig höhere Renditen abwerfen. Wie aber entwickeln sich solche Faktoren wie Value oder Quality tatsächlich im Zeitverlauf? In dieser Ausgabe von Indices Insight lassen wir die Daten für sich sprechen und beleuchten, wie sich diese Faktoren im Vergleich zu anderen halten. Spoiler-Alarm: Während ihre Renditen einem kräftigen Auf und Ab unterliegen können, liegen Faktoren am Ende oft vor ihren Kontrahenten.
Auf die Vergangenheit bezogene Untersuchungen zeigen, dass es über die Aktienprämie hinaus eine ganze Reihe weiterer Faktorprämien gibt. Dabei sprechen wir über die Prämien der Faktoren Value, Momentum, Quality, Low-Risk und Size (oder Small-Cap).
Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf jeden der einzelnen Faktoren. Der Value-Effekt entspricht der Unterstützung eines Außenseiters. Aktien, die unterbewertet oder billig erscheinen, z. B. gemessen am Kurs/Buchwert-Verhältnis, entwickeln sich in der Regel besser als ihre teureren (Growth-)Pendants.1 Beim Momentum-Effekt dagegen geht es darum, auf ein Pferd zu setzen, das bereits am gewinnen ist. Aktien, die in letzter Zeit gut abgeschnitten haben (Gewinner), werden sich wahrscheinlich auch weiterhin besser entwickeln2 als die Verlierer.
Dann gibt es den Quality-Effekt, bei dem man auf Titel mit sehr gutem Profil vertraut. Aktien von Unternehmen mit hoher Profitabilität und niedrigen Investitionen (High Quality) übertreffen typischerweise solche mit geringer Profitabilität und hohen Investitionen (Low Quality oder Junk)3. Der Low-Risk-Effekt4 ist die Finanzmarktvariante von „Gemächlich und stetig zahlt sich aus“. Aktien mit geringem Risiko tendieren dazu, höhere risikobereinigte Renditen als Titel mit hohem Risiko abzuwerfen. Der Size-Effekt schließlich ist zwar nicht so ausgeprägt wie die anderen Effekte. Er bedeutet aber, dass Small-Cap-Aktien häufig ihre Large-Cap-Pendants übertreffen.5
Auch wenn die genauen Definitionen6 dieser Faktorprämien für gewisse Diskussionen sorgen, sind sie durch Evidenz aus langen Zeiträumen belegt. Dazu zählen Daten aus den USA, die bis in die 1960er oder sogar 1920er Jahre zurückreichen, außerdem internationale Daten ab den 1990er Jahren. Die untenstehende Abbildung basiert auf gängigen Definitionen7 und auf Renditedaten von US-Aktien.
Aus unseren Analysen ergibt sich klar, dass die Mehrzahl der Faktoren seit 1967 über nahezu alle 3-Jahres-Zeiträume durchgängig ihre Pendants übertroffen haben. So haben die meisten Faktoren (seien es drei, vier oder alle fünf) die meiste Zeit über eine höhere Rendite abgeworfen als ihre Alternativen. Das bedeutet aber nicht, dass sich Faktoren immer gleichmäßig entwickeln. Zeitweilig können sie zurückbleiben, wie das während des Dotcom-Booms der Fall war. Damals schnitten IT-fokussierte Wachstumsaktien besser ab als Value-Titel von traditionelleren Unternehmen. Auch in jüngerer Zeit (zum Beispiel zwischen 2017 und 2020) hinkten mehrere Faktoren über einen 3-Jahres-Zeitraum ihren Pendants hinterher. Doch Faktoren erholen sich typischerweise wieder von einem Rückschlag, und genau das ist seit 2021 geschehen.
Unsere Abbildung basiert auf den monatlichen Erträgen von US-Aktien aus der Datenbank von Professor Kenneth French.8 Unsere Ergebnisse basieren auf Portfolios, die nach Quintilen der Marktkapitalisierung und anderen Quintilen sortiert sind, die das Buchwert-Kurs-Verhältnis (Value vs. Growth), die Rendite der letzten zwölf Monate ohne den letzten Monat (Gewinner und Verlierer), das univariate Markt-Beta der letzten fünf Jahre (niedriges Beta und hohes Beta), die operative Rentabilität (hohe Profitabilität vs. niedrige Profitabilität) oder die Veränderung der Assets zwischen den letzten beiden Geschäftsjahren (niedrige Investitionen und hohe Investitionen) berücksichtigen. Anschließend wird der Durchschnitt der obersten und untersten Quintile über alle Größengruppen hinweg ermittelt, um die endgültigen Faktoren und ihre Pendants zu bestimmen.
Der Value-Faktor beispielsweise basiert auf der Durchschnittsbildung der fünf nach Größe sortierten Portfolios mit dem höchsten Buchwert/Marktwert-Verhältnis. Ähnlich verhält es sich mit dem Faktor Growth, bei dem wir den Durchschnitt der fünf nach Größe sortierten Portfolios mit dem niedrigsten Buchwert/Marktwert-Verhältnis ermitteln. Dasselbe Verfahren wird bei den anderen Faktoren und ihren Pendants wiederholt. Anschließend berechnen wir den Faktor High Quality und sein Pendant Low Quality durch Gleichgewichtung der sich ergebenden Portfolios aus Unternehmen mit hoher Profitabilität und niedrigen Investitionen bzw. mit niedriger Profitabilität und hohen Investitionen. Der Small Cap-Faktor basiert auf dem untersten Quintil der Verteilung nach Marktkapitalisierung und sein Pendant, der Large Cap-Faktor, auf dem obersten Quintil.
Die Renditen sind die annualisierten rollierenden geometrischen Dreijahresrenditen in USD im Zeitraum von Januar 1969 bis März 2023.

Subscribe - Indices Insights
Receive an update as soon as a new article is available with insights about sustainability, factors or markets.
Fazit
Der Beweis für die Existenz von Faktorprämien liegt auf der Hand. Unsere Analyse zeigt, dass die Faktorprämien trotz eines gewissen Auf und Ab über einen Zeitraum von drei Jahren in den meisten Fällen vorne liegen.
Quellen der verwendeten Bilder in der Reihenfolge ihrer Wiedergabe:
AP Photo/Horst Faas (CC BY 2.0), Library of Congress/Thomas J. O'Halloran (Wikimedia Commons), White House Photographic Collection (Wikimedia Commons), Library of Congress/Bernard Gotfryd (public domain), Unsplash/Jose Francisco Fernandez Saura (public domain), Library of Congress/Carol Highsmith (public domain), Unsplash/Breno Assis (public domain), Urban~commonswiki (Wikimedia Commons), InvadingInvader (Wikimedia Commons), Unsplash/Markus Spiske (public domain), Pexels/Mathias Reding (public domain).
Fußnoten
1 Siehe beispielsweise E. F. Fama & K.R. French, The cross‐section of expected stock returns, in: Journal of Finance, 1992, 47(2), S. 427-465.
2 Vgl. beispielsweise N. Jegadeesh & S. Titman, Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. in: Journal of Finance, 48(1), 1993, S. 65-91.
3 Siehe beispielsweise E. F. Fama & K.R. French, A five-factor asset pricing model, in: Journal of Financial Economics, 116(1), 2015, S. 1-22.
4 Siehe beispielsweise F. Black, M.C. Jensen und M. Scholes, The capital asset pricing model: some empirical tests. Studies in the Theory of Capital Markets, Praeger, 1972. Oder aus jüngerer Zeit: D.C. Blitz und P. van Vliet, The volatility effect. in: Journal of Portfolio Management, 34(1), 2007, S. 102-113.
5 Siehe beispielsweise R.W. Banz, The relationship between return and market value of common stocks, in: Journal of Financial Economics, 9(1), 1981, S. 3-18.
6 Für einen Überblick zu unterschiedlichen Definitionen des Faktors Quality siehe beispielsweise G. Kyosev, M.X. Hanauer, J. Huij und S. Lansdorp, Does earnings growth drive the quality premium?, in: Journal of Banking and Finance, 114, 2020, 105785.
7 Es ist nicht das Ziel dieses Indices Insights-Artikels zu erörtern, wie Faktoren am besten definiert werden oder wie Faktorstrategien am besten in der Praxis umgesetzt werden. Wer sich dafür interessiert, findet bei uns auf Anfrage eine Vielzahl von Research-Material.
8 Siehe https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html